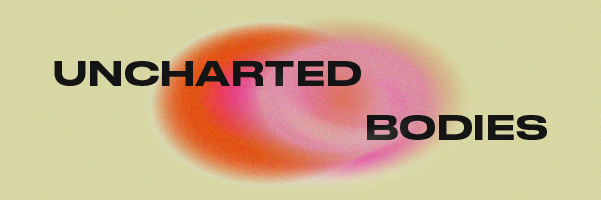Warum wissen wir 2020 immer noch mehr über Erektionsstörungen als über PMS?
Photographed by Eylul Aslan
„PMS hat irgendwie was Volkstümliches“, sagt Charlie. „Überleg mal: Deine Mutter hatte PMS, ihre Mutter auch, und diese ganzen Frauen mussten das alles jeden Monat still und leise ertragen. Und niemand konnte irgendwas dagegen tun.“
Charlie leidet unter der prämenstruellen dysphorischen Störung (kurz PMDS), einer besonders ernsten Form des prämenstruellen Syndroms (PMS). Menschen mit PMDS leiden in den Wochen vor ihrer Periode nicht “bloß“ unter körperlichen Beschwerden, sondern zusätzlich unter psychischen Symptomen wie extremen Stimmungsschwankungen und teilweise sogar Suizidgedanken. Das betrifft circa drei bis acht Prozent aller Menstruierenden. Die 30-jährige Charlie bekam allerdings zuerst eine falsche Diagnose: bipolare Störung. „Irgendwann fiel mir dann ein Muster meiner Stimmungsschwankungen auf – meinem Zyklus entsprechend“, sagt Charlie.
WerbungWERBUNG
Sie erklärt: „Du kannst mit der Störung nur wirklich Frieden schließen, wenn du akzeptierst: Du bist und bist gleichzeitig nicht nur deine Hormone. Und du musst irgendwo damit Frieden schließen, ob du nun damit klarkommst oder nicht, denn es keine einfache, schnelle Lösung für deine Beschwerden gibt es nicht.“
Die schwächer ausgeprägte Form, das prämenstruelle Syndrom, betrifft rund 90 Prozent aller menstruierenden Menschen. Doch obwohl seine Symptome bei bis zu 20 Prozent aller Menstruierenden schon als „klinisch relevant“ und somit ernster gelten, gehen nur etwa drei bis acht Prozent damit zum Arzt bzw. zur Ärztin. Und selbst dort ist die Hilfe nicht gewährleistet: Obwohl dem PMS inzwischen mehr als 200 verschiedene Symptome zugeordnet werden, zweifeln laut Dr. Kimberly Yonkers, Professorin der Psychiatrie, Geburtskunde und Gynäkologie an der Yale University, immer noch viele Mediziner*innen an der Existenz des Syndroms.
„Und dann gibt es da noch auch die wohlmeinenden Personen, die glauben, die PMS-Diagnose sorge für die Stigmatisierung der “hysterischen Frau“ nur weiter befeuern; ihnen wäre es lieber, wenn es gar nicht diagnostiziert wird“, sagt Dr. Yonkers, die das prämenstruelles Syndrom seit über zwei Jahrzehnten untersucht. „Ich hingegen gehe dabei auf meine Patient*innen ein. Ich kann ihnen ja schlecht sagen: ‚Ach, das bilden Sie sich bloß ein‘, immerhin leiden sie ja wirklich.“
Seit der heute veraltete Begriff “premenstrual tension“ (“prämenstruelle Anspannungen“) im Jahr 1931 in einem Artikel des New Yorker Arztes Dr. Robert T. Frank zum ersten Mal auftauchte, sind viele Jahrzehnte vergangen. Trotzdem kann sich die Wissenschaft immer noch nicht erklären, wie PMS entsteht, geschweige denn, wie man es erfolgreich behandeln könnte. Tatsächlich kommen laut ResearchGate auf jede Forschungsarbeit zu PMS fünf Studien zum Thema Erektionsstörung (auch Potenzstörung oder erektile Dysfunktion, kurz ED). Dabei betrifft letztere schätzungsweise vier bis sechs Millionen Menschen in Deutschland. Das sind knapp zehn bis 15 Prozent – verglichen mit den geschätzten 90 Prozent der Menstruierenden mit prämenstruellem Syndrom. Wie kann es also sein, dass wir vergleichsweise viel über etwas wissen, das deutlich weniger Leute betrifft?
WerbungWERBUNG
Dr. Yonkers erklärt sich das folgendermaßen: Es gibt nur eine Handvoll von Personen, die in ihrem Gebiet forschen. Außerdem sei sie eine der wenigen Forscher*innen, die von der medizinischen Forschungseinrichtung der USA, den National Institutes of Health (NIH), die entsprechenden Mittel bekäme. Tatsächlich wird PMDS erst seit 2013 offiziell anerkannt, seit es ins amerikanische Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) aufgenommen wurde. Diese Liste hilft Ärzt*innen weltweit bei der Diagnose psychischer Erkrankungen. „Das war für uns ein großer Schritt: Es war ein weiteres Argument für die Bedeutung unserer Forschung“, sagt Dr. Yonkers. „Aber wenn wir mal ehrlich sind, in den USA, aber auch in anderen Gebieten der westlichen Welt, besteht die Tradition, die Beschwerden und Leiden von Frauen nicht ernst zu nehmen.“
Die älteste Beschreibung von Symptomen, die wie wir heute wissen zyklusbedingt sein können, findet man übrigens in einem ägyptischen Schriftstück namens Gynäkologischer Papyrus von Kahun (etwa 1850 v. Chr.). Der Papyrus führte Beschwerden wie Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Unterleibsschmerzen und starke Blutungen auf, die der „wandernden Gebärmutter“ zugeschrieben wurden – einem bösen Wesen, das im Frauenkörper lebt. Die damals noch unerklärlichen Mysterien der weiblichen Geschlechtsorgane wurden lange Zeit auch mit Hexerei und dämonischer Besessenheit in Verbindung gebracht.
Das prämenstruelle Syndrom ist also ein Jahrtausende altes Leiden – und trotzdem weiterhin größtenteils ungeklärt. Charlie half es allerdings schon, ihren Stimmungsschwankungen, Konzentrationsproblemen und der generellen Lethargie endlich einen Namen geben zu können. „Zu wissen, dass das alles mit meinem Zyklus zu tun hat, hat für mich viel verändert: Plötzlich war mir klar, jedes Tief ist nur vorübergehend – alles folgt einem bestimmten Rhythmus“, sagt sie. „Egal, wie schlimm ich mich zwischendurch fühle: Es beschränkt sich alles nur auf diese bestimmte Zeit. Ich genieße und nutze die Wochen ohne PMS daher umso mehr.“
WerbungWERBUNG
Dr. Peter Schmidt, führender Forscher am amerikanischen National Institute of Mental Health, untersucht das Prämenstruelle Syndrom schon seit den 1980ern. Er hofft, irgendwann die Ursache, mögliche Behandlungsmethoden sowie den Grund für die Schwankungen von Person zu Person herauszufinden. Er sagt, seine Forschungen deuten bisher darauf hin, PMS würde nicht „von einem Mangel oder Überschuss eines bestimmten Hormons“ verursacht werden, sondern durch die unterschiedlichen Reaktionen einzelner Körper auf normale zyklische Hormonschwankungen. Warum manche Menstruierende dafür anfälliger sind als andere, ist noch nicht klar.
2017 stieß Dr. Schmidt auf Indizien einer möglichen genetischen Veranlagung zu PMDS. „Das kann entweder bedeuten, sie wurden mit diesen Genen geboren, oder aber es handelt sich um – und das ist in dieser Studie besonders relevant – epigenetische Veränderungen. Das heißt, die Umgebung hätte sich auf die Gene ausgewirkt.“
Als die Studie erschien, nannte sein Kollege Dr. David Goldman die Ergebnisse „einen großen Durchbruch für die weibliche Gesundheit“. Er sagte, die PMDS-Symptome seien damit nachweislich „nicht einfach emotionales Verhalten, das die Betroffenen kontrollieren können sollten“. Dr. Schmidt hofft, das NIH kann auf seinen Ergebnissen aufbauen und anhand dessen ein neues PMDS-Medikament aus Dutasterid entwickeln (der Stoff kommt bisher bei der Behandlung vergrößerter Prostata zum Einsatz). Aktuell werden weitere Genom-Studien durchgeführt, die eventuell weitere Behandlungsmethoden hervorbringen könnten; ihre Ergebnisse liegen jedoch noch in ferner Zukunft.
Obwohl es weiterhin kein Heilmittel für PMDS gibt, lässt Dr. Yonkers Forschung zumindest vermuten, dass Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SRIs), die zur Behandlung von Antidepressiva verwendet werden, Patient*innen mit PMDS helfen könnten. Bei einigen schwächt die Antibabypille die Symptome zumindest ab; andere berichten, durch eine Ernährungsumstellung, mehr Bewegung oder den Verzicht auf Rauchen und Alkohol eine Besserung bemerkt zu haben.
WerbungWERBUNG
Fiona Jenkins betreut auf Facebook eine Support-Gruppe für PMDS-Betroffene und hat dort selbst erlebt, wie unterschiedlich sich Behandlungsmethoden auf unterschiedliche Menschen auswirken können. „Ich persönlich kann nicht hormonell verhüten; das wirkt sich zu sehr auf meine Psyche aus. Andere hingegen verhüten mit der Pille und haben dadurch viel weniger Probleme“, erklärt sie. „Ich musste erst lernen, anderen keine subjektive Meinung aufzudrücken.“
Die Mittzwanzigerin Maddie Campion gehört zu den Betroffenen, bei denen Sport hilft. „Ich habe angefangen, zur Arbeit zu laufen und seit Beginn der Pandemie fahre ich viel Fahrrad. Das macht einen riesigen Unterschied“, sagt sie. Sie findet auch, dass mit dem prämenstruellen Syndrom immer noch viele Mysterien verbunden sind, die es Betroffenen erschweren, ihre eigenen Beschwerden einzuordnen. „Meine Freundin twitterte: ‚Ich will einmal meine Tage haben, ohne immer Durchfall zu kriegen!‘. Und ich dachte mir nur: ‚Wow, ich dachte, das geht nur mir so!‘. Weil kaum jemand drüber sprichst, kannst du nie wissen, was als “normal“ gilt“, so Maddie.
Um Menstruierenden und Ärzt*innen dabei zu helfen, die Symptome zu tracken und zu behandeln, hat die Psychotherapeutin Carolyn Janda während ihrer Ausbildung an der Uni Marburg ein Symptom-Tagebuch entwickelt, das die Diagnose schwerer Fälle von PMS und PMSD erleichtern soll. Über zwei Zyklen hinweg sollten Menstruierende ein Tagebuch ausfüllen, indem sie 30 Fragen zu den laut DSM-V elf typischen PMSD-Symptomen beantworteten. Dieselbe Symptomliste wurde auch für die PMS-Diagnose verwendet, doch mit weniger strengen Kriterien als für PMSD. Die dort aufgeführten Symptome waren: Schwierigkeiten mit der Gefühlsregulation; Reizbarkeit, Wut oder häufigere Auseinandersetzungen; depressive Verstimmungen, Angstgefühle oder Anspannung; ein schwächeres Interesse für alltägliche Aktivitäten; Konzentrationsprobleme; Trägheit; Appetitveränderungen; Schlaflosigkeit oder -sucht; ein Gefühl der Überwältigung oder des Kontrollverlusts; und zuletzt körperliche Symptome wie beispielsweise Gewichtszunahme.
WerbungWERBUNG
Janda untersuchte außerdem die Vorurteile gegenüber PMDS-Betroffenen und fand heraus, dass sich die Meinung von Befragten zu PMDS-Patient*innen verbesserte, wenn sie mehr über die Erkrankung erfuhren. Wie auch Dr. Yonkers sieht Janda die Aufnahme von PMDS ins DSM-V als Wendepunkt für Forscher*innen. Sie merkt jedoch auch an, es war nicht immer leicht, andere Akademiker*innen zur ernsthaften Betrachtung des Themas zu ermutigen. „In der Forschung wird man oft dafür belächelt“, erzählt sie. „Als wir 2012 damit anfingen, interessierte sich niemand für das Problem. Das hat sich erst in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt.“
Als Rachel, 27, vor einigen Monaten erstmals schwere PMS-Symptome erlebte, fand sie es eigenen Angaben zufolge zu schwer, das mir ihren Vorgesetzten zu besprechen. Und das, obwohl sich die Beschwerden auf ihre Arbeit auswirkten. „Ich fühlte mich einfach furchtbar. Ich lag im Bett und dachte: Oh Gott, soll ich mich heute krankmelden? Ich will echt nicht zur Arbeit“, erinnert sie sich. „Es wäre mir enorm unangenehm gewesen, deswegen dem Typen von HR eine Mail zu schreiben oder ihn anzurufen. Er ist zwar generell sehr verständnisvoll, aber trotzdem“, sagt sie. „Mit einer Erkältung bleibst du zu Hause, klar. Aber das prämenstruelle Syndrom wird einfach weniger akzeptiert.“
Obwohl der Gender-Bias sicher mitverantwortlich für den wissenschaftlichen Rückschritt zu PMS ist, betont Dr. Michael Craig, Psychiater in der Female Hormone Clinic vom London Maudsley Hospital, es gibt noch weitere Hürden, die der Forschung dazu im Weg stehen. Dr. Craig gehört zur britischen National Association for Premenstrual Syndromes und erzählt, wie schwer es ist, die vielfältigen Symptome vom PMS als solche zu identifizieren. „Das Problem dabei ist: Je nachdem wie du PMS definierst, beziehst du entweder zu viele Symptome mit ein und machst damit umso mehr Menschen zu Patient*innen oder aber du begrenzt das prämenstruelle Syndrom auf nur wenige Symptome – und verwehrst dadurch Menschen eine Behandlung, die sie wirklich gebrauchen könnten.“
WerbungWERBUNG
Das Ganze wird weiter dadurch erschwert, dass PMS in mehrere medizinische Kategorien fällt, sagt Dr. Craig. „Eine der Schwierigkeiten ist, Medizin-Studierende werden immer spezifischer ausgebildet“, erklärt er. „Gynäkolog*innen lernen kaum etwas über das Thema Psyche und Psychiater*innen erfahren nur wenig über Gynäkologie. Dadurch entstehen Lücken in der Behandlung von PMS und anderen Beschwerden. Und wer darf versuchen, sie zu füllen? Die Allgemeinmediziner*innen, von denen sich manche für PMS interessieren – und manche eben nicht. Es glauben ja nicht einmal alle an dessen Existenz.“ Du siehst also: Nicht einmal die Expert*innen sind sich bei der Herangehensweise einig.
Eines ist laut Sally King, Doktorandin am Department of Global Health & Social Medicine am Londoner King’s College, allerdings sicher: Wir behandeln PMS völlig falsch. Ihr Interesse am Syndrom hat sie der Erkenntnis zu verdanken, dass ihr regelmäßiges Gefühl der Übelkeit zyklusbedingt war. 2016 rief sie dann die Website Menstrual Matters ins Leben. Dort bündelt sie Informationen zu den Auswirkungen hormoneller Veränderungen und bietet User*innen einen Online-Symptom-Tracker, mit dessen Hilfe sie und ihre Ärzt*innen idealerweise normale hormonelle Symptome von anderen zugrunde liegenden Erkrankungen unterscheiden können sollen.
Sally wünscht sich „eine eindeutigere, auf Beweisen beruhende Definition von Zyklus-Symptomen. Am besten eine, die uns bei der Erstellung einer Liste der typischsten PMS-Symptome hilft. So fällt die Diagnose einfacher, Studienergebnisse lassen sich besser miteinander vergleichen und die alltäglichen Erfahrungen Menstruierender sind vielleicht irgendwann nicht mehr so vorurteilsbelastet.“
Für die nachweisbar zyklusbedingten psychologischen und körperlichen Beschwerden macht Sally aber kein “Syndrom“ verantwortlich. „In unserer Gesellschaft, und auch in der Gesundheitsforschung, herrschen immer noch genderspezifische Narrative vor“, sagt sie und fügt hinzu, weibliche Reizbarkeit oder Wut gelte schnell als “schlecht“ oder “unweiblich“. „Wir neigen dazu, die Schuld an diesen Gefühlen unseren Körpern in die Schuhe zu schieben – anstatt einer Situation, die diese Emotionen in uns ausgelöst hat. Vielleicht sind wir durch das prämenstruelle Syndrom generell reizbarer, aber letztlich stecken hinter richtigen Gefühlsausbrüchen meist äußerliche Auslöser. Nicht unsere Zyklen, nicht unsere Körper!“
WerbungWERBUNG
Sally – übrigens die Autorin von Premenstrual Syndrome (PMS) and the Myth of the Irrational Female (Das Prämenstruelle Syndrom und der Mythos der hysterischen Frau) – betont außerdem, dass andere PMS-Symptome, wie beispielsweise Gewichtszunahme oder Pickel, gar nicht als “Symptome“ gelten würden, würde die Wissenschaft weibliche Körper anders betrachten. „So etwas hat einfach mit normalen hormonellen Schwankungen zu tun. Niemand würde sich daran stören, wenn wir nicht dem Druck ausgesetzt wären, immer perfekt auszusehen. Und “perfekt“ heißt eben dünn und pickelfrei.“
Sally untersucht in ihrer Doktorarbeit den Diskurs rund um das prämenstruelle Syndrom, und wie dieser von Gender-Vorurteilen beeinflusst wird. Sie ist fest davon überzeugt, dass sich die Forschung viel mehr darauf konzentrieren sollte, wieso der Menstruationszyklus andere Erkrankungen wie Migräne, Reizdarmsyndrom, Epilepsie und Asthma verschlimmern kann. „Wenn wir herausfinden würden, was die unterschiedlichen physiologischen Veränderungen sind, die solche Beschwerden verstärken können, könnten wir mehr über den Menstruationszyklus herausfinden, aber auch darüber, was die Beschwerden hervorruft – bei Frauen und Männern.“
Dr. Craig sagt, es gibt immer auch ein politisches Element in Bezug darauf, welcher Art der Gesundheitsforschung die größte Priorität zugesprochen wird. Daher kämpfen die PMS-Forscher*innen weiterhin um Mittel. Ihre Konkurrenz: Mediziner*innen, die sich beispielsweise der Behandlung von Krebs, Herzerkrankungen oder aktuell eben COVID-19 widmen. „Manchmal gelten solche Erkrankungen auf der politischen Agenda eben als wichtiger. Vor nicht allzu langer Zeit bekam beispielsweise die geistige Gesundheit werdender oder frischgebackener Mütter viel Aufmerksamkeit – mehr als noch vor einem Jahrzehnt. Darin flossen demnach auch viele Gelder“, sagt er. „Die PMS-Forschung hat es bisher nicht geschafft, so viel Interesse oder finanzielle Unterstützung zu generieren.“
Während die Wissenschaft in dieser Hinsicht also auch nach Jahrtausenden immer noch relativ am Anfang steht, geht es Menschen wie Charlie hauptsächlich darum, PMS und PMDS einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Dafür ist vor allem eines wichtig: Ein Umfeld, das verständnisvoll und einsichtig auf sie reagiert. In der Vergangenheit hatte Charlie sogar selbst Schwierigkeiten, ihre Symptome zu verstehen. „Lange Zeit dachte ich, ich werde verrückt“, sagt sie. „Es wäre so schön, wenn wir jemand eine Lösung all meiner Probleme präsentieren könnte. Ich gehe aber fast davon aus, dass das nie passieren wird.“
WerbungWERBUNG